Gefundene Schätze
Unser Ortsheimatpfleger Rudolf Nintzel stellt "Gefundene Schätze" zu Ihlienworth vor.
De Dübel, de kann gorkeen Ingelsch

Den 8. Mai 1945 weer de osige Krieg to Ind. De Englänner keemen öber uns in’n Land Hodeln. All wat manken de Mehm un den Hodler Konol leeg, dat weer dat Kriegsgefangenengebiet. Dorüm worrn op de Brüchen ingelsche Posten opstellt. In Helmworth op de Mehmbrüch stünn uck so een Tommy vör sien Schillerhuus.
In Moler Reisen sien Huus dor weern se in Quarteer gohn, un dorüm snacken de Helmworther blos no von dat »Englänner-Huus«. Öber de Mehmbrüch keem keen een röber, de sien Kennkort nich to Hölp harr un vörwiesen kunn.
Bie de Meieree weer de grode Bodderkarrn twei. De Mann mit den »Maschinenkopp«, de müß dor her un de wohn güntsied de Mehm in Oster-Helmworth. De swung sick nu forts op sienen Drothesel un kajüdel int Westerdörp.
Op de Brüch stünn de Englänner und versparr em den Weg: „Paß!“ „Wat is dat?“ „Paß!“ — „Wat heet hier Paß“, anter Hermann, de Maschinist, den harr he nich bie sick, „ich will doch man blos, eben dor, da drüben, nach Molkerei, du verstehen, Maschin kaputt!“
De Englänner verstünn nix un keem no mol mit: „Paß!“ Se worrn sick nich eenig, un Hermann weer bannig fünsch un vergrellt. Ingelsch müssen nu köhnen.
Hein ut de Rosenstroot keem dor nu öberto un frog nu bannig klook: „Du, du, du mien Hermann, ward, ward, ward jie ju nich eenig?“ „Och, wie woll, de Hund, disse Englänner, de kann jo keen Dütsch!“
„Du, du, du, dat kriegt wie, züh, züh, ick bün jo in, in, in Ameriko wehn, ick, ick snack ins mit em. He, Mister, hör, hörto, de Mann, the Menn, he will iff jur plies no de anner Siet, no the Melk, Melkeree.“
De Englänner verstünn keen Wort un nu kreeg Hein dor uck den Kreller bie un meen düll: „Du, mien Hermann, wees wat, de, de, de, de Dübel, de kann gorkeen Ingelsch!“
Werner Tietje aus Neuenkirchen war der Autor dieser kleinen Plattdeutschen Geschichte, sie wurde in den 1970er-Jahren in der Niederelbe-Zeitung veröffentlicht.
„Hein ut de Rosenstroot“ ist Heinrich Stelling aus der Rosenstraße gewesen, er stotterte etwas, war nach Amerika ausgewandert und zurückgekehrt. Der „Maschinist“ war der Meierei-Mechaniker Hermann Karsten aus der Osterstraße.
Milchverkauf vor 80 Jahren in Ihlienworth | um 1940

Von 1887 bis 1983 gab es in Ihlienworth eine Meierei. Die dort angelieferte Milch wurde verarbeitet und auch durch Milchverkäufer und Milchverkäuferinnen verkauft. Seit 1934 hat Claus Feil diese Tätigkeit ausgeführt. Er belieferte seine Kunden in Ihlienworth und Neuenkirchen zunächst mit Pferd und Wagen, später motorisiert. Nachdem er 1941 zum Kriegsdienst eingezogen wurde, übernahmen im Dorfkern von Ihlienworth seine Frau Johanne Feil und Margarete Brüning diese Tätigkeit.
Dazu wurde eine Handkarre mit 35 Liter Vollmilch und zwei 20 Liter Kannen Buttermilch von den Frauen beladen. Die wohl 100 kg schwere Handkarre zogen sie durch die Hauptstraße, die Osterstraße und Rosenstraße. Mit einer Handglocke machten sie auf sich aufmerksam. Die Milch wurde mit einem Litermaß in die Gefäße der Kundschaft abgefüllt, bezahlt wurde in bar. Zeitweise hat auch Johanne Feil´s Tochter Marianne die Milchverkäuferinnen auf ihrer Tour begleitet.
Nachdem Walter Godlewski im November 1951 mit der Einrichtung eines Milchverkaufsstandes gegenüber der Meierei an der Hauptstraße begonnen hatte, wurde wenig später der Milchverkauf mit der Handkarre eingestellt. Frisch abgefüllte Milch konnte dann noch am Milchstand und beim Kaufmann Heinrich Springer in der Hauptstraße gekauft werden.
Auf dem Foto sind Johanne Feil aus der Osterstraße (links) und Margarete Brüning aus Dreihausendorf zu sehen.
Die letzte Überschwemmung im Hadelner Sietland | 1951 im Januar

Jahrhundertelang war das südlich von Ihlienworth unter dem Meeresspiegel liegende Hadelner Sietland im Herbst und Winter häufig vom Wasser der umliegenden Moor- und Geestländereien überschwemmt. Erst nach dem Bau eines Stufenschöpfwerkes in Ihlienworth im Jahr 1928 und eines Mündungsschöpfwerkes in Otterndorf 1929 konnten 12 500 Hektar des Sietlandes ausreichend entwässert werden. Die Landwirte hatten jetzt die Möglichkeit, eine geregelte und beständige Landwirtschaft zu betreiben.
Im Herbst des Jahres 1950 fiel die einzige Pumpe des mit Diesel betriebenen Otterndorfer Mündungsschöpfwerkes wegen eines größeren Motorschadens über einen längeren Zeitraum aus. Die Stufenschöpfwerke in Ihlienworth und Nordleda mussten daraufhin ihren Betrieb einstellen, da eine Entwässerung in die Elbe nur noch durch die natürliche Vorflut erfolgen konnte. Über 8000 Hektar des Hadelner Sietlandes waren damals bis in das Frühjahr 1951 überschwemmt und standen teilweise bis zu 0,50 m unter Wasser. Die Wintersaaten wurden vernichtet und die Frühjahrsbestellung der Felder musste weit hinausgeschoben werden, wodurch große Ernteschäden entstanden. Als Folge wurde ein zweites Schöpfwerk in Otterndorf geplant und 1954 in Betrieb genommen.
Diese Überschwemmung war die letzte großflächige seit dem Bau der ersten Schöpfwerke. Bis auf wenige Ausnahmen mit hohen Niederschlagsmengen konnte die künstliche Entwässerung des Sietlandes zufriedenstellend durchgeführt werden.
Das Foto vom Januar 1951 zeigt eine mit zwei Milchkannen beladene Flöte im Hadelner Sietland.
Arbeit in der Traditionsschmiede Woltmann in Ihlienworth | um 1965

Am 1. Mai 1908 erwarb Wilhelm Woltmann vom Schmiedemeister Tiedemann einen Schmiedebetrieb in der Osterstraße in Ihlienworth. Zuvor hatte er nach einer Lehre beim Schmiedemeister Rodegerdts in Ihlienworth-Medemstade bei verschiedenen Meistern in der Umgebung als Geselle gearbeitet. Nach und nach wurde der Betrieb vergrößert und 1953 an den ältesten Sohn Hinrich abgegeben. Dieser erweiterte den Betrieb um eine Tankstelle und eine Traktorvertretung. Dessen Sohn Gerhard war der letzte Besitzer der Schmiede.
Der Schmiedemeister Gerhard Woltmann (rechts) ist hier mit seinem Altgesellen Alfred Fortmeyer am Amboss zu sehen.
Heuernte in Ihlienworth-Medemstade | 1920er Jahre

In den Sommermonaten war die Heuernte die wichtigste Arbeit auf einen Bauernhof, da sonst die Tiere im Winter nichts zu fressen hatten. Dann roch es überall auf dem Lande nach frischem Heu. Gemäht wurde im Juni, wenn das Gras ausgeblüht und es „Heuwetter“ war. Es musste also ein längerer Zeitraum trocken sein. Mähbeginn war am Vormittag, nachdem das Gras abgetrocknet war. Nach dem Mähen wurde das Gras vor allem von Frauen und Kindern mehrere Tage lang mit einer Forke gewendet. War es dann trocken, wurde es in Haufen (Diemen) gepackt und auf von Pferden gezogenen Ackerwagen eingefahren. Das Heu wurde beim Beladen von einem Mann auf dem Wagen entgegengenommen und dort fachgerecht gepackt. War der Ackerwagen voll, wurde die Ladung mit einem hinten und vorne mit Seilen festgezogenen „Bindebaum“ gesichert und zum Hof gefahren. Dort wurde das Heu auf den Heuboden geworfen.
In früheren Zeiten wurde das Gras vom Bauern mit seinen Söhnen, Knechten und Tagelöhnern noch mühselig mit der Sense gemäht. Später kam ein Mähwerk mit Messerbalken zum Einsatz, welches von einem Pferd gezogen wurde. Das Mähwerk wurde über die Räder angetrieben. Ab den 1950/60er Jahren wurde das Pferd von einem Traktor und der Messerbalken ab den 1970er Jahren durch ein Mähwerk mit rotierenden Drehtellern ersetzt.
Unterhaltungsarbeiten am Schöpfwerk Ihlienworth | 1955

Dieser ungewöhnliche Anblick bot sich im Sommer 1955, als aufgrund von Wartungsarbeiten der Medemabschnitt vor dem Zulauf des Ihlienworther Schöpfwerkes sechs Wochen lang trockengelegt wurde. Zunächst wurden beide Kreiselpumpen (Elektro und Diesel) ausgebaut und überholt. Die Elektropumpe konnte daraufhin direkt wieder eingesetzt werden. Für die Dieselpumpe konnten jedoch keine Ersatzteile für die Lager der Kurbelwelle beschafft werden – der ehemalige Lieferant befand sich in der Ostzone – woraufhin ein komplett neuer Motor angeschafft wurde.
Zimmermeister Heinrich Oest aus Medemstade und Schmiedemeister Karsten reparierten zwei Unterwassertore aus Holz sowie die zwei Tore der Kahnschleuse. Zwei der Unterwassertorflügel, die seit der Umleitung der Emmelke nicht mehr benötigt werden, wurden gänzlich entfernt. Eine Mauer trennt seitdem die Einläufe zu den beiden Pumpen. Ebenfalls wurde der Freilauf auf der Südseite zugemauert. Durch diese bauliche Veränderung kann künftig eine der beiden Pumpen repariert werden, während die andere weiter in Betrieb bleibt.
Um den stellenweise mehr als ein Meter hohen Schlick abzutransportieren, der sich vor dem Schöpfwerk abgelagert hatte, wurde als letzter Arbeitsschritt die fruchtbare Erde von Arbeitern in Loren geschaufelt, welche mit einer Winde über das Ufer gezogen und in einen Graben entleert wurden.
Nach Abschluss der Arbeiten mussten die Spundwände, die das Wasser ferngehalten hatten, wieder herausgezogen werden. Mit Handarbeit oder Winden war dies nicht möglich, denn die dicken Bohlen sitzen bis über drei Meter im Schlick. Erst ein Trecker brachte diesen Kraftakt zu Stande, sodass das Schöpfwerk Ende August wieder geflutet werden konnte.
Kökschen im Gasthaus Katt in Ihlienworth | Bild von 1957

Seit ungefähr 1800 gibt es in der Osterstraße in Ihlienworth eine Gastwirtschaft. Gegründet wurde sie von Claus Meyer, der sie 1843 an seinen Sohn Gottlieb weitergab. 1878 folgten als Besitzer Nicolaus Schwanemann und 1924 Ernst Stockfisch. 1956 übernahm Berthold Katt die Gastwirtschaft, zunächst als Pächter, später hat er sie gekauft. Heutige Besitzerin ist Sandra Woltmann, die Enkelin von Berthold Katt.
In den 1950er Jahren waren Suppenhochzeiten im Hadelner Sietland sehr beliebt. Dort wurde die Hadelner Hochzeitssuppe von vielen fleißigen „Kökschen“ zubereitet und von den Nachbarn des Brautpaares als Aufträger den Hochzeitsgästen serviert. Während des Essens wurden Tellersammlungen vorgenommen. Zuerst für die „Kökschen“, mit der schalkhaften Bemerkung, sie haben sich Hemd und Schürze verbrannt, danach für die Musikanten und die Armen im Dorf.
Das Foto entstand während der Hochzeit von Rudolf und Hedwig Jäger am 24. August 1957.
Die „Kökschen“ von links: Paula Stockfisch, Ella Langkabel, Gerda Hoffmeister, Ina Brockmann, Erika Neben, Frieda Schmeelk, Marie von Thun und Hilda Katt.
Weihnachten im Kriegswinter 1944
1936 wurde in Ihlienworth beim Schöpfwerk das Reichsarbeitsdienst-Lager aufgebaut und erstmalig durch eine Abteilung aus Crossen an der Oder belegt. Hauptaufgabe war die Entwässerung des Sietlandes.
Nach der Auflösung des RAD-Lagers wurde es im 2. Weltkrieg als Lazarett genutzt und ab dem Herbst 1944 in ein Ausbildungslager der Wehrmacht umgewandelt. Dort waren zwei Fallschirmjäger Maschinengewehr-Ausbildungs-Bataillione bis März 1945 stationiert.
Eine gute Beschreibung des Ausbildungsalltags liefert ein Bericht von Erwin Pirr aus Butzbach aus dem Jahr 2011. Mit siebzehn Jahren zur Luftwaffe gekommen, lernte er in Ihlienworth die harte achtwöchige Ausbildung zum Fallschirmjäger kennen.
Gravierend war ein Erlebnis zu Weihnachten 1944, deshalb meldete sich in der Erinnerung von Erwin Pirr der Ort „Ihlienworth“ immer zur Weihnachtszeit. Nachfolgend seine Erinnerungen:
„Wir alle siebzehn- und achtzehnjährigen hatten die harte Ausbildung hinter uns. Der Abtransport an die Front stand bevor. Es war wenige Tage vor Weihnachten und man war zum ersten Mal Weihnachten nicht zu Hause. Jeder von uns hoffte auf Post und ein Päckchen von zu Hause. Nach fünf Jahren Krieg war die Infrastruktur im Land kaputt. Die Städte, Bahnhöfe, Gleisanlagen waren zerbombt. Tiefflieger machten Jagd auf die Lokomotiven von Eisenbahnzügen. Die Postzustellung war nicht mehr sicher. Wir waren zu sechst in einer Barackenstube untergebracht. Nur ein Weihnachtpäckchen von zu Hause hatte einen Kameraden an unserem abgelegenen Ort erreicht. Sein Päckchen erhielt einen kleinen Kuchen, wie man sie in Blechformen gebacken hat. Der Kuchen wurde brüderlich geteilt, ich bekam auch ein kleines Stück. Geteilt durch sechs wurden aus dem Kuchen sehr kleine Stücke.
Der Bürgermeister aus dem nahe gelegenen Ort Ihlienworth hatte eingeladen, wonach Soldaten den ersten Weihnachtsfeiertag ab Spätnachmittag bei Familien im Ort verbringen durften. Mir und meinem Kumpel hatte man ein Haus weitab vom Lager im Außenbereich zugewiesen. Wir mussten das Haus wegen ungenauer Beschreibung bei einem Marsch durch hohen Schnee erst einmal suchen. Ein Mann und seine Frau betrieben dort ihre Landwirtschaft. Den Mann bekamen wir beim Betreten des Hofes nur ganz kurz zu sehen. Die Frau geleitete uns recht einsilbig in ein Zimmer, stellte einen Teller mit Plätzchen auf den Tisch und verließ sofort wieder den Raum. Da saßen wir „Soldätchen“ nun in dieser fremden, öden Stube. Kein Weihnachtsbaum, kein Radio mit Weihnachtsmusik wie man das von zu Hause gewöhnt war, nicht einmal eine Kerze. Vielleicht haben wir uns unterhalten, wie es bei jedem zu Hause war. Wahrscheinlich die Plätzchen verzehrt, stumpfsinnig vor sich hingedöst und mit den Gedanken weit weg im Elternhaus.
Unsere Gastgeber bekamen wir nicht mehr zusehen. Ich habe oft darüber nachgedacht, was wohl der Grund dafür war, dass sie sich nicht einmal wenige Minuten zu uns setzten. Vielleicht hatten sie selbst Angehörige im Krieg und schlechte Nachrichten erhalten.
Wir machten uns dann wieder auf den beschwerlichen Weg bei Eiseskälte durch Dunkelheit und Schnee zurück zu unserem Lager.

Das Weihnachtspäckchen von zu Hause mit von der Mutter gebackenen Plätzchen und Kuchen kam drei Tage nach Weihnachten bei mir an. In meinem langen Leben ist jedes Jahr zu Weihnachten dieses Erlebnis in Ihlienworth in der Erinnerung präsent.
Wenige Tage später begann unser Transport an die Ostfront. Wir wurden zwischen den Jahren 1944/45 mit der Bahn hinter Krakau und Tarnow an die Weichsel verlegt. Ein Brief meiner Eltern vom 18.12.1944 erreichte mich in Ihlienworth nicht mehr.
Am 15. März 1945 wurde ich an der Oder schwer verwundet, kam nach Prag in ein Lazarett und dann nach Bayern. Am 5. August 1945, drei Tage vor meinem 18. Geburtstag, kam ich aus der Gefangenschaft nach Hause. Diese Erlebnisse in so jungen Jahren haben Spuren für das Leben hinterlassen.“
Grabung auf der Joost-Worth in Dreihausendorf im Jahr 1939

Vier Wochen vor der 800-Jahrfeier am 23. Juli 1939 wurde auf Ihlienworths höchster Worth in Dreihausendorf vom Kreiskulturpfleger Karl Waller eine Grabung durchgeführt. Dabei kam heraus, dass die Worth und damit auch die Siedlung Ihlienworth zu diesem Zeitpunkt mindestens etwa 1000 Jahre alt ist.
Nachfolgend das Protokoll der Ausgrabung:
Wurten sind Dokumente der Marschbesiedlung.
Kreiskulturpfleger Waller = Cuxhaven.
Wenn Ihlienworth am kommenden Sonntag die 800jährige Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung von 1139 festlich begehen wird, drängt sich von selbst die Frage auf, wie alt diese Marschsiedlung am Rande des Sietlandes überhaupt schon sein mag. Diese Frage kann nicht aus den Urkunden und Akten beantwortet werden, der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist allein der Spaten des Vorgeschichtsforschers. Aber wo soll der Forscher den Spaten ansetzen, da die Oberfläche der weiten Marsch keine Grabhügel oder Siedlungsspuren erkennen lässt? Seit einigen Jahrzehnten ist bekannt, dass die alten Wohnhügel in der Marsch, die man im Lande Hadeln Worthen nennt, schon sehr alt sein können und dass sie oftmals viele Reste einer früheren Besiedelung in den einstige Wohnschichten erhalten haben. Es war daher selbstverständlich, dass man zur Bestimmung der Ihlienworther Besiedlungsgeschichte eine alte Wurt untersuchen müsste. Die Auswahl war allerdings nur gering, in der gesamten Feldmark Ihlienworth sind heute nur noch zwei Wurten als solche erkennbar: die alte Kirchenwurt und eine Wurt in Dreihausendorf auf dem Grundstück des Bauern Joost. Da es aus selbstverständlichen Gründen nicht passend erscheint, eine Kirchwurt zu einer Ausgrabung auszuwählen, blieb nur die Wurt von Dreihausendorf zur Auswahl übrig, und ich benutze gern die Gelegenheit, dem Besitzer der Wurt Herrn Bauer Joost an dieser Stelle meinen Dank dafür auszusprechen, dass er in so entgegenkommender Weise die Erlaubnis zur Grabung gegeben und bei der Grabung mich in jeder Weise so weitgehend unterstützt hat.
Die Grabung wurde am 24. Juni d.J. durchgeführt in der Weise, dass an einer besonders hohen Stelle der Wurt ein Schacht von 2 m Kantenlänge bis auf den gewachsenen Kleiboden hinuntergeführt wird. Alle Scherben und ähnlichen Funde werden sorgsam gesammelt und mit Tiefenangabe versehen. Es müsste ein besonderer Zufall sein, wenn bei einer solchen Schachtgrabung Reste der früheren Häuser angeschnitten würden, es wurde daher auch kaum mit dieser Möglichkeit gerechnet. Die Ausbeute an bestimmbaren Scherben bedingt den Wert der Grabung. Danach kann die Grabung in Dreihausendorf als durchaus ergebnisreich bezeichnet werden; denn sie lieferte 47 einigermaßen bestimmbare Gefäßscherben. Sie lagerten in einer Tiefe von 50 – 140 cm unter Wurthöhe. Die tiefsten Scherben auf 140 cm waren mittelalterlich, eine davon zeigte die Eigenarten der karolingischen Kugeltöpfe. Unter dieser Schicht begann in 165 cm Tiefe der gewachsene Kleiboden, unter dem keine weiteren Siedlungshorizonte mehr angetroffen werden konnten.
Die bestimmbaren Scherben gehörten teils dem Mittelalter, teils dem 16. - 18. Jahrhundert an, die Lagerung der zeitlich unterschiedlichen Scherben ist so regelmäßig, dass man an ihnen die jeweilige Wurtenhöhe feststellen und ablesen kann. Aus dieser Grabung ergibt sich Folgendes für die Geschichte der Wurt von Dreihausendorf und damit auch für die Siedlung Ihlienworth im Allgemeinen: im Gegensatz zu den großen Seeworthen von Lüdingworth, Dörringworth und Neuenkirchen reicht die Ihlienworther Wurt nicht in vorgeschichtliche Zeit zurück, sondern sie verdankt ihren Ursprung der zweiten Wurtenbesiedlung im 8. – 9. Jahrhundert d. Z(ei)tr(echnung). In der Folgezeit ist sie durch Grüpen und durch Verwendung vorhandener Erdmassen in regelmäßigen Abschnitten erhöht worden. Sie hat anscheinend nur eine Hofstelle getragen.
Das Ergebnis dieser Grabung und auch das Material sollen in der Ausstellung im Jugendheim zur Darstellung gebracht werden. Da es den Besuchern nicht leichtfallen wird, aus den Topfscherben die einstigen Gefäße zu erkennen, werden neben den Ihlienworther Scherben aus den Museen von Hamburg (Mus. für Kunst und Gewerbe), Cuxhaven und Otterndorf ganze Gefäße gleicher Zeit und gleicher Form gezeigt.
Das älteste Zeugnis von Ihlienworth ist danach der Kugeltopf von Dreihausendorf aus dem 9. Jahrhundert, dieser Fund berechtigt uns, das Alter der Siedlung Ihlienworth auf rund 1000 Jahre anzunehmen.
Ausstellung im Hitlerjugend-Heim (ehemaliges zweites Pfarrhaus in der Rosenstraße) während der 800-Jahrfeier. Mittig an die Wand gelehnt der karolingische Kugeltopf.
Der Milchkahnfahrer auf der Alten Aue | Bild von 1959

Von 1887 bis 1969 wurde in Ihlienworth die Milch von den Bauernhöfen auch über die örtlichen Flussläufe und Wettern mit Milchkähnen zur Meierei in der Ortsmitte gebracht. Ursache dafür waren die schlechten Wegeverhältnisse und die häufigen Überschwemmungen vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Hier fährt Johannes Nintzel einen Milchkahn auf der Alten Aue, kurz vor dem Schöpfwerk. Nintzel musste sich diesen Kahn mit einer Länge von fünf Metern für 210 DM von seinem Vorgänger Heinrich Nowatzki aus Neuenkirchen kaufen. Ab dem 1. Mai 1952 begann er mit seiner Arbeit, für einen Lohn von vier DM am Tag, zuletzt verdiente er 12 DM am Tag. Bis zu 17 Landwirte musste er dazu anfahren, die Fahrt dauerte einschließlich Be- und Entladen etwa viereinhalb Stunden, acht Kilometer war die Strecke auf der Medem, Gösche und der Alten Aue lang. Nintzel war Milchkahnfahrer bis zum 31. März 1960. Sein Nachfolger wurde Erich Rohr aus Neuenkirchen, er war der letzte Milchfuhrmann, der bis zum 31. März 1969 die Milchkannen mit dem Kahn transportierte. Danach wurde die Milch mit Traktor und Wagen zur Meierei gefahren.
Arbeit im Hochmoor | Bild von 1959

Während der Mechanisierung der Landwirtschaft in den 1950er Jahren haben in den Moorgebieten des Hadler Sietlandes kleine, leichte Traktoren die Pferde ersetzt. Auf den nassen Moorböden war außerdem oft eine Spurverbreiterung an den Antriebsrädern der Traktoren notwendig, um bei der Arbeit nicht im Moor zu versinken. Viele umfangreichere Arbeiten wurden oft mit Hilfe der Nachbarn durchgeführt.
Zu sehen ist ein in Ihlienworth Medemstade im Hochmoor arbeitender Trecker der Marke Ritscher mit angebauter Grabenschnecke. Die Grabenschnecke wurde im Hochmoor zum Ziehen von Entwässerungsgräben eingesetzt. Dazu war immer ein zweiter Trecker erforderlich, der zur Unterstützung mit einem Seil den Trecker mit angebautem Grabengerät zog. Mit der Schnecke wurde an einer gedachten Grabenseite entlang gefahren und die erste Grabenböschung ausgehoben. In einem zweiten Schritt fuhren die Trecker entgegengesetzt auf der anderen Grabenseite zurück und hoben die zweite Grabenböschung aus. In der Mitte des Grabens blieb allerdings immer noch ein Moorkeil stehen, der anschließend per Hand mit dem Spaten herausgeworfen wurde. Aber eine Grabenschnecke war schon eine große Erleichterung.
Kuhlmaschine in der Marsch des Landes Hadeln | Bild um 1930

Beim „Kuhlen“ handelte es sich um eine Methode der Bodenverbesserung in den Elbmarschen. Unter dem Mutterboden und einer unfruchtbaren Bodenschicht, „Dwoog“ genannt, liegt eine helle, kalkhaltige Erdschicht. Von dieser „Kleierde“ wurden große Mengen nach oben geholt, um die oberen Erdschichten fruchtbarer zu machen. Dies geschah seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts in Handarbeit. Dabei wurde aus runden Löchern von 2-3 Metern Tiefe die Kleierde mit Holzspaten („Raweier“) nach oben befördert. Von diesen „Kuhlen“ rührt der Name der Tätigkeit her. Kuhlmaschinen lösten seit 1928 die vorher praktizierte schwere Handarbeit ab. 1992 wurde der Betrieb der letzten Maschine im Land Kehdingen eingestellt.
Die Kleierde wird aus einer Tiefe von bis zu 3 Metern gefördert, ohne dass dabei ein Umschichten der darüber liegenden Erdschichten notwendig ist. Die Kuhlmaschine besitzt einen großen Bohrrüssel, der bis in die Kleierde hineingetrieben wird. Am unteren Ende befindet sich der Bohrkopf, an dem Messer befestigt sind. Diese schneiden die Kleierde auf und befördern sie in das Innere des Rüssels. Mit einer dort angebrachten Transportschnecke wird sie an die Oberfläche transportiert und mit einer Schleuder beidseitig der Maschine verteilt. Die Kuhlmaschine bewegte sich mit ca. 80 m pro Stunde über den zu bearbeitenden Acker.
Die linke Person auf dem Foto ist Otto Timm aus Osterbruch.
Das Foto ist im Kalender „Arbeiter/Innen in Stadt und Land Cuxhaven“ aus dem Wilhelm-Heidsiek-Verlag erschienen.
Einsatz eines Eimerkettenbaggers in Ihlienworth | Bild von 1930er Jahre

Jahrhundertelang war der größte Feind des Hadelner Sietlandes das Wasser. Vom Herbst bis zum Frühjahr eines jeden Jahres standen weite Flächen des Landes vollständig unter Wasser. In diesen Zeiten war das einzige Verkehrsmittel der Kahn. Nicht nur der Transport von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auch Visiten, Einkäufe, zur Geburt und zur Beerdigung – alles wurde auf dem Wasserwege abgewickelt. Eine erste Verbesserung dieser Lage wurde durch den Bau des Hadelner Kanals (1854) erreicht, der für die Entwässerung des Landes sorgte. Aber erst mit dem Bau der Schöpfwerke in Ihlienworth und Otterndorf in den Jahren 1928/29 konnten die jährlichen Überschwemmungen wirklich gebannt werden. Nach dem Bau der Schöpfwerke war die vorrangige Aufgabe des Medemverbandes die Vorfluter in Ordnung zu bringen, um das Wasser den Schöpfwerken auch zügig zuführen zu können. Unter anderem musste auch die Medem in Ihlienworth ausgebaggert werden.
Zu sehen ist der im Jahre 1937 vom Medemverband erworbene Eimerkettenbagger, der zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Der Bagger wurde in Einzelteilen über Land transportiert und am Einsatzort wieder zusammen gebaut. Im Hintergrund ist die Hengststation zu sehen.
Belegschaft der Meierei Ihlienworth | Bild von 1975
Am 14. März 1887 wurde der Grundstein der Meierei-Genossenschaft Ihlienworth gelegt. Damit wurde den ansässigen Landwirten die Möglichkeit gegeben, ihre Milch gewinnbringend abzusetzen. Das Hadelner Sietland war damals aufgrund der schlechten Wegeverhältnisse praktisch von der übrigen Wirtschaft abgeschlossen. Der 8. November 1887 war mit 484 Liter Milch der erste Anlieferungstag. Die Liefermenge stieg kontinuierlich und erreichte 1908 2700 Tonnen im Jahr. Diese Menge wurde kriegsbedingt erst 1934 wieder erreicht. 1952 wurde der Betrieb der Meierei von Dampf auf Strom umgestellt. In den Jahren bis 1960 wurden zudem Butterei, Betriebsraum, Milchlager, Annahme und Weichkäserei ausgebaut.
Aufgrund der schlechten Kosten- und Erlössituation und nachdem in der Organisation und Verwaltung der Meierei zusätzlich gravierende Mängel festgestellt wurden, kam es 1983 zur Betriebsstillegung.
Die Mitarbeitenden auf dem Foto von links: Reinhard Oest, Christa Badura, Gerd Wörmcke, Heinrich Brümmer, Werner Haß, Claus Huntenburg, Werner Wichmann, Walter von Deesten, Marianne Jarck und Geschäftsführer Hartmut Albers.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass von 1937 bis zum Ende der NS-Diktatur das Büro der Ihlienworther NSDAP-Ortsgruppe in der Meierei untergebracht war. Der Betriebsleiter Bernhard Wilkens war gleichzeitig Ortsgruppenleiter. Er wurde noch im Mai 1945 interniert.
Lohnfuhrunternehmen in Ihlienworth | Bild aus ca. 1960er Jahre
Am 15. Oktober 1920 kaufte sich der Ihlienworther Wilhelm Tiedemann sein erstes Pferd und begann, mit Pferd und Wagen die Milch vom Straßdeich zur Meierei in der Dorfmitte zu fahren. Zuvor, seit dem 1. Januar 1920, hatte er die Milchanfuhr mit einem Kahn über Wettern und Medem getätigt. Es dauerte nicht lange, bis ein zweites Pferd gekauft werden musste und schon bald hat Tiedemann das Milchfahren aufgegeben und ein Lohnfuhrunternehmen gegründet. Manche Fuder Sand, Steine, Bauholz, Baumstämme und vieles andere rollten so über die Straßen. Außerdem wurde er von vielen Stellen zum Einbringen der Ernte gerufen und verrichtete er die Müllabfuhr in der Gemeinde. Neben seiner täglichen Arbeit hat er zudem 30 Jahre lang den Leichenwagen gefahren und manche Ihlienworther und Ihlienwortherinnen zur letzten Ruhe gebracht.
Auch ehrenamtliche Fahrten wurden von Tiedemann geleistet. Bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel fuhr er lange Zeit die damalige Handspritze. Und im Schützenverein war er mit seinem Fuhrwerk bei den Festumzügen dabei, um die Ehrenmitglieder und ältere Festteilnehmer und Festteilnehmerinnen durch die Straßen zu fahren.
Wilhelm Tiedemann hat unzählige Kilometer mit seinem Pferdegespann hinter sich gebracht, wobei wohl so mancher Schweißtropfen geflossen ist, aber auch so mancher „Köm“ vereinnahmt wurde.
Buch: Ihlienworth - Perle des Sietlandes
Die durch Heimatbeiträge und Bücher bekannte Autorin Gisela Tiedemann-Wingst legt nach mehrjähriger Arbeit dieses umfangreiche, reich bebilderte Heimatbuch vor.
Das Buch "Ihlienworth - Perle des Sietlandes" enthält Wissenswertes über die Geschichte des weitgehend landwirtschaftlich geprägten Ortes. So spielte die Verbesserung des Bodens durch das sogenannte „Kuhlen“ eine besondere Rolle. Die Kirche St. Wilhadi, ihre Kunstschätze und Geschichte wird ausführlich beschrieben. Dem ewigen Kampf mit dem Wasser bis hin zum Bau des Schöpfwerks wird nachgegangen. Die Geschichte der Meierei, der Spar- und Darlehnskasse und der Kreissparkasse wird erzählt. Den Windmühlen, Geschäften und Gaststätten sind ausführliche Berichte gewidmet und nicht zuletzt dem Holzmarkt, der zum Schweinemarkt mutierte. Die durch Heimatbeiträge und Bücher bekannte Autorin legt nach zehnjähriger Arbeit dieses umfangreiche, reich bebilderte Heimatbuch vor.
Das Buch "Ihlienworth" von Gisela Tiedemann kann im Bürgerbüro Ihlienworth erworben werden.

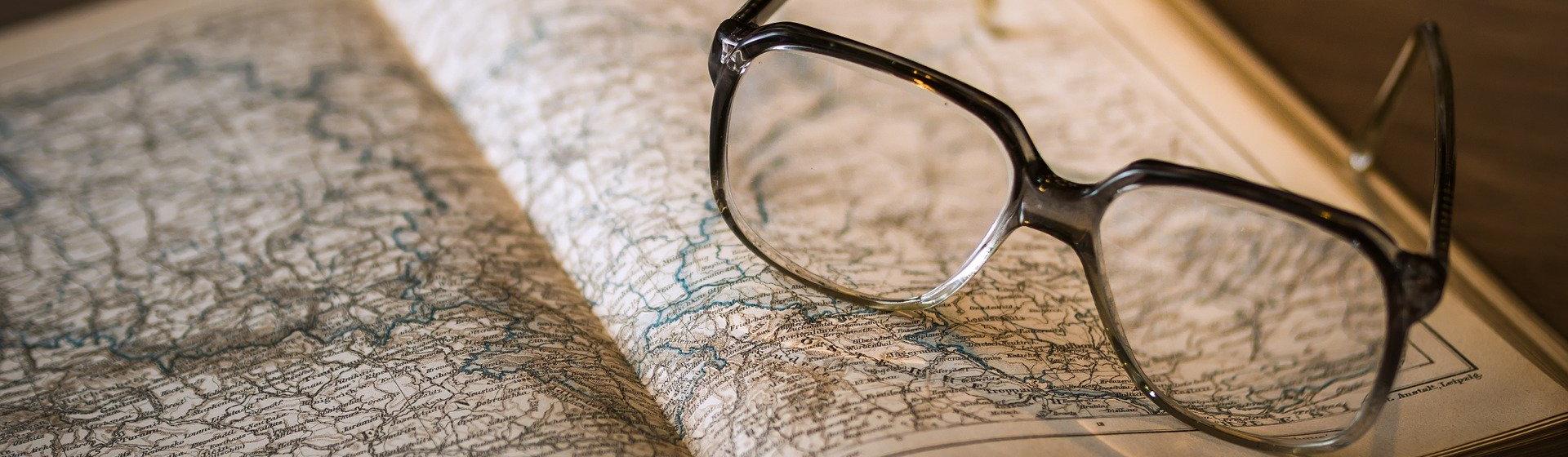




 Land.Hadeln.de
Land.Hadeln.de